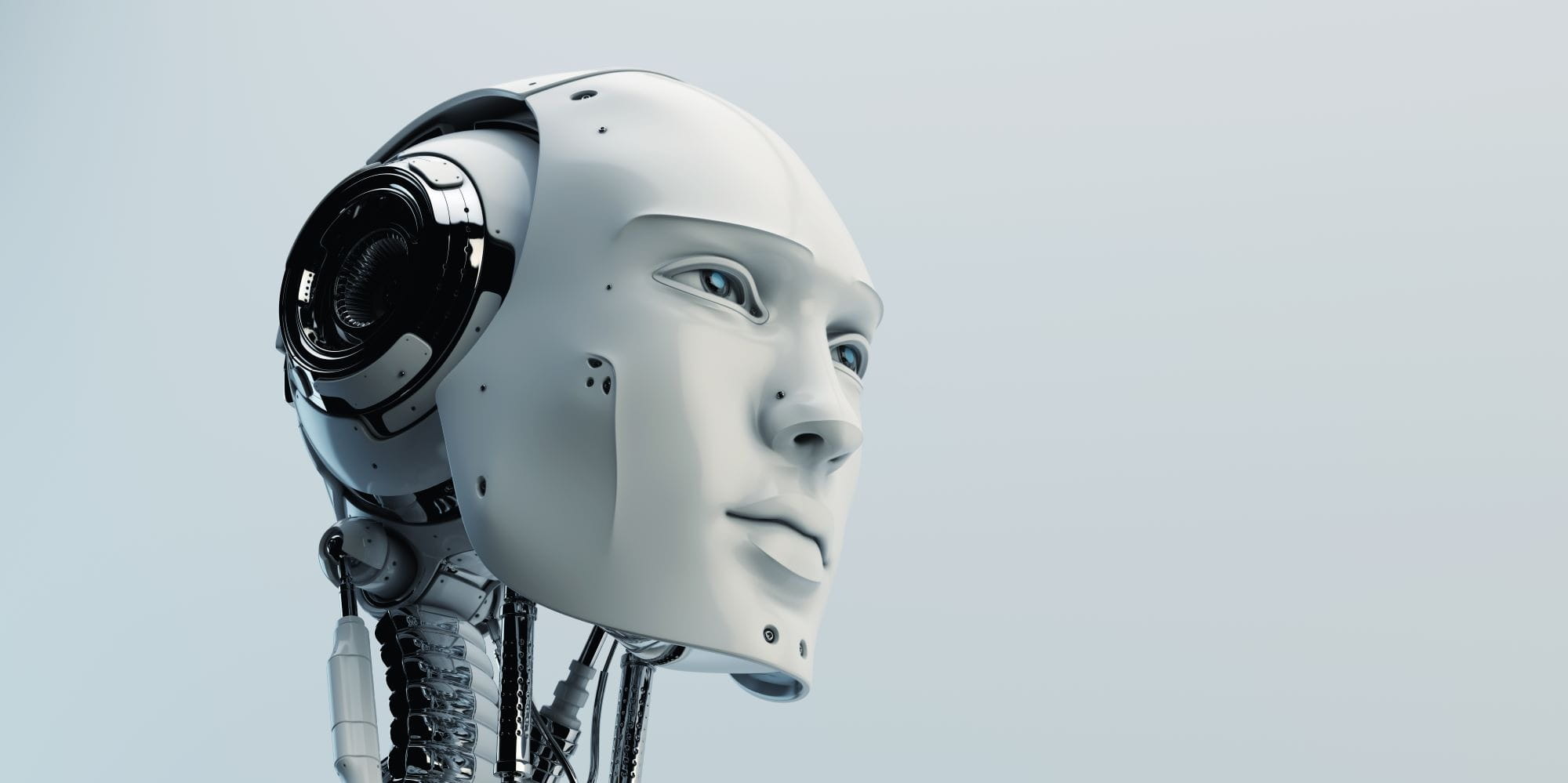
What are the most pressing digital topics?
 Suche
Suche


 Suche
Suche

Verordnung (EU) 2024/900– ein Name, der nach technischer Nüchternheit klingt, in Wahrheit aber erhebliche Sprengkraft birgt. Seit ihrer Veröffentlichung im März 2024 setzt die „Verordnung über die Transparenz und das Targeting politischer Werbung“ neue Maßstäbe im Spannungsfeld von Demokratie, Digitalisierung und Compliance. Ziel ist es, die Integrität politischer Prozesse zu schützen und eine offene und faire politische Debatte zu unterstützen (vgl. Art. 1 Abs. 4). Vor allem für Unternehmen aus den Bereichen Werbung, Medien, Technologie und Datenanalyse, aber auch für alle weiteren natürlichen und juristischen Personen, die politische Werbung sponsern, anbieten oder herausgeben tritt im Oktober 2025 ein deutlich verschärftes regulatorisches Umfeld in Kraft.


Die Verordnung verlangt von Anbietern, Herausgebern und Sponsoren politischer Werbung künftig ein hohes Maß an Offenlegung. Damit wird ein europaweit einheitlicher Rahmen geschaffen, der den bisherigen Flickenteppich nationaler Regelungen ablöst – und zugleich erheblichen Anpassungsdruck für Unternehmen bedeutet.
Konkret muss jede politische Anzeige künftig klar gekennzeichnet sein, Angaben dazu enthalten im Kontext welcher Wahl oder welchem Referendum sie geschaltet wird und offenlegen, ob sie gezielt im Rahmen von Targeting- bzw. Anzeigeschaltungsverfahren eingesetzt wurde (Art. 11 Abs. 1). Außerdem müssen sie u. a. die folgenden Informationen im Rahmen einer „Transparenzbekanntmachung“ offenlegen (Art. 12):


Der Begriff ist weit gefasst: Er umfasst
Diese Definition ist somit sehr weit gefasst. Nicht erforderlich hingegen ist eine Verbindung zu einem politischen Akteur, wie das Wort „oder“ deutlich macht. Auch politische Aufrufe von Unternehmen, Verbänden oder NGOs können daher politische Werbung sein, sofern sie geeignet und darauf ausgerichtet sind, politische Prozesse zu beeinflussen.


Die Verordnung richtet sich an Anbieter (Art. 3 Nr. 6), Herausgeber (Art. 3 Nr. 13) und Sponsoren (Art. 3 Nr. 10) politischer Werbung. Die Kategorien lassen sich am besten an folgendem Beispiel verdeutlichen.
Beauftragt eine politische Partei A die Agentur B mit der Gestaltung und Platzierung einer Online-Werbekampagne bei dem sozialen Netzwerk C und der Online-Suchmaschine D, so gilt die Partei A als Sponsor, die Agentur B als Anbieter politischer Werbedienstleistungen und das soziale Netzwerk C sowie die Online-Suchmaschine D als Herausgeber.
Aufgrund der weiten Definition der „politischen Werbung“ könnte aber auch ein Wahlaufruf von Unternehmen / Verbänden oder NGOs politische Werbung sein und entsprechende Verpflichtungen auslösen.
Jeder dieser Akteure unterliegt eigenen Transparenz-, Kennzeichnungs- und anderen Handlungspflichten (siehe hierzu vorletzter Absatz „Inkrafttreten und Handlungspflichten"). Die klare Abgrenzung der Rollen ist entscheidend für die rechtskonforme Umsetzung politischer Werbung.
Für die Praxis bedeutet dies, dass sämtliche Beteiligte bei der Verbreitung politischer Werbung – von der finanzierenden Partei bis hin zum Plattformbetreiber – die jeweiligen Vorgaben der Verordnung beachten müssen, um empfindliche Sanktionen zu vermeiden. Die Regelungen erstrecken sich dabei über den gesamten Prozess der politischen Werbung, von ihrer Finanzierung bis zur öffentlichen Verbreitung.


Die Verordnung beschränkt die Möglichkeiten zur Verarbeitung personenbezogener Daten bei Targeting- bzw. Anzeigeschaltungsverfahren für politische Werbung im Internet erheblich. In diesen Fällen gilt zukünftig:
Überdies bestehen weitere Überschneidungen mit dem Datenschutz mit detaillierten Vorgaben.


In den letzten drei Monaten vor einer Wahl oder einem Referendum dürfen außereuropäische Akteure keine politische Werbung mehr sponsern, wenn sie nicht nachweisen können, dass sie in der EU ansässig sind (Art. 5 Abs. 2).


Die Verordnung sieht ein scharfes Sanktionsregime vor, das Unternehmen zwingt, Transparenz- und Targeting-Vorgaben nicht als bloße Formalität zu behandeln. Verstöße gegen die Vorgaben der Verordnung können mit wirksamen, verhältnismäßigen und abschreckenden Geldbußen von bis zu sechs Prozent der Einnahmen bzw. des weltweiten Jahresumsatzes (Art. 25 Abs. 1) geahndet werden. Die genaue Höhe der finanziellen Sanktionen muss noch von den jeweiligen Mitgliedstaaten festgelegt werden. Die Sanktionen können auch andere Maßnahmen wie Zwangsgelder und Unterlassungsaufforderungen durch die zuständigen Behörden beinhalten (Art. 25 Abs. 1 und 5).
Für Unternehmen ergibt sich daraus ein doppeltes Risiko: Neben den finanziellen Sanktionen droht ein erheblicher Reputationsschaden. Politische Werbung ist besonders sensibel, und öffentliche Verstöße werden nicht nur juristisch, sondern auch medial geahndet. Vorstände und Compliance-Verantwortliche sollten daher sicherstellen, dass interne Kontrollsysteme rechtzeitig an die neuen Anforderungen angepasst werden.


Die Verordnung verdeutlicht, wie stark sich Geopolitik und digitale Regulierung inzwischen überlagern. Multinationale Unternehmen müssen künftig die europäischen Anforderungen in ihre weltweiten Compliance-Strukturen integrieren, sofern sie politische Werbung in der Union verbreiten, veröffentlichen oder sich diese an Unionsbürger richtet (Art. 2 Abs. 1: Anwendbarkeit unter den genannten Voraussetzungen auch auf Anbieter mit Niederlassung außerhalb der EU).
Dies kann zu Konflikten mit anderen Rechtsordnungen führen – insbesondere in Märkten, in denen Targeting-Methoden weniger streng reguliert sind. Wie schon bei der Nachhaltigkeitsregulierung zeigt sich, dass Unternehmen zunehmend im Spannungsfeld divergierender Rechtsrahmen operieren und ihre Strategien entsprechend ausrichten müssen.


Für Geschäftsleitungen ergibt sich damit ein klarer Handlungsauftrag: Politische Werbung darf nicht mehr als Randthema betrachtet werden, sondern gehört in den Bereich strategischer Compliance- und Risikomanagemententscheidungen. Betroffen sind nicht nur klassische Werbeagenturen, sondern auch alle Unternehmen, die politische Werbung anbieten, herausgeben oder sponsern, wie z. B. Plattformbetreiber, Datenanalysten, Medienhäuser und Unternehmen.


Die Verordnung (EU) 2024/900 trat im April 2024 in Kraft, gilt in Großteilen jedoch erst ab dem 10. Oktober 2025 (Art. 30). Sie entfaltet in allen Mitgliedstaaten der EU unmittelbare Wirkung.
Unternehmen sollten kurzfristig prüfen, ob die Regelungen Auswirkungen auf von ihnen angebotenen oder finanzierten Werbetätigkeiten haben und sofern notwendig die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die nachstehenden Pflichten zu erfüllen.
Für Unternehmen die als Anbieter (Art. 3 Nr. 6) oder Herausgeber (Art. 3 Nr. 13) politischer Werbung agieren ergeben sich aus der Verordnung die folgenden Handlungspflichten:
Auch natürliche und juristische Personen, die Werbung sponsern (Art. 3 Nr. 10) sollten ihre Prozesse überprüfen und ggf. anpassen. Für diese ergeben sich aus der Verordnung vor allem die folgenden Handlungspflichten:
Verfasst von Christian Ritz und Felix Werner.